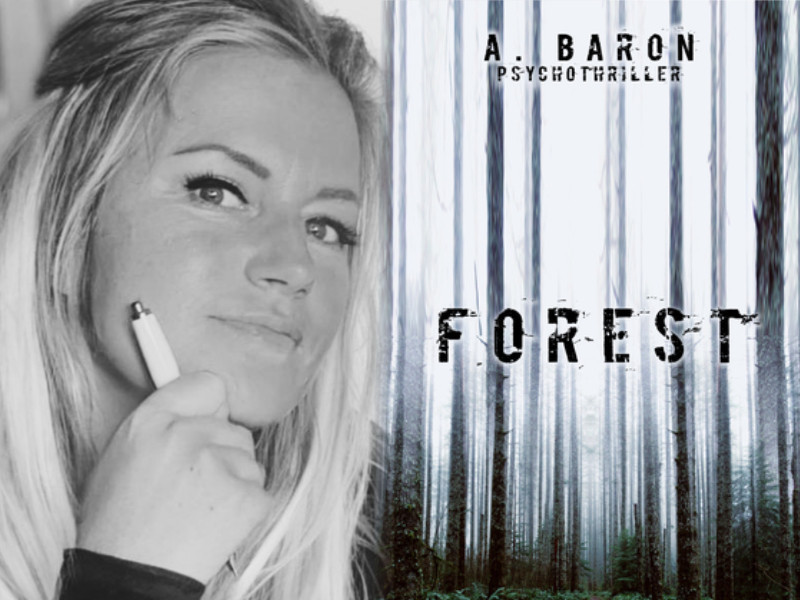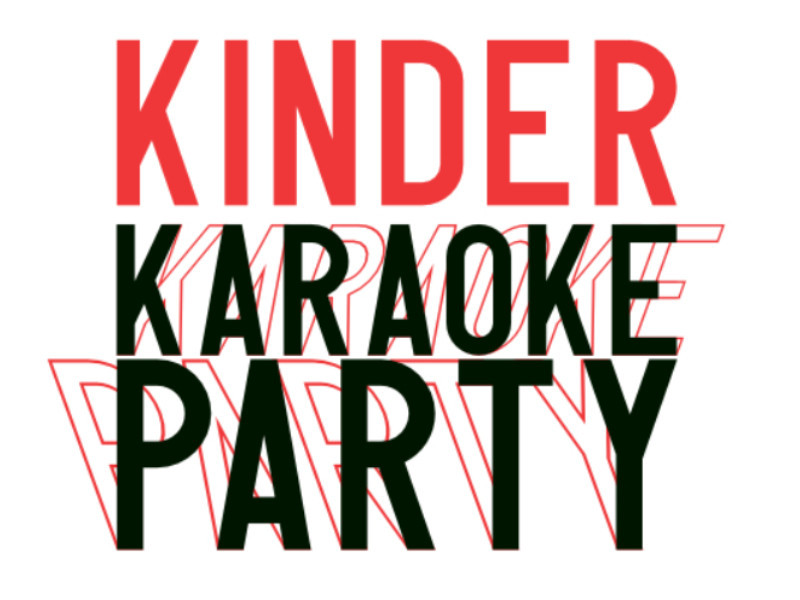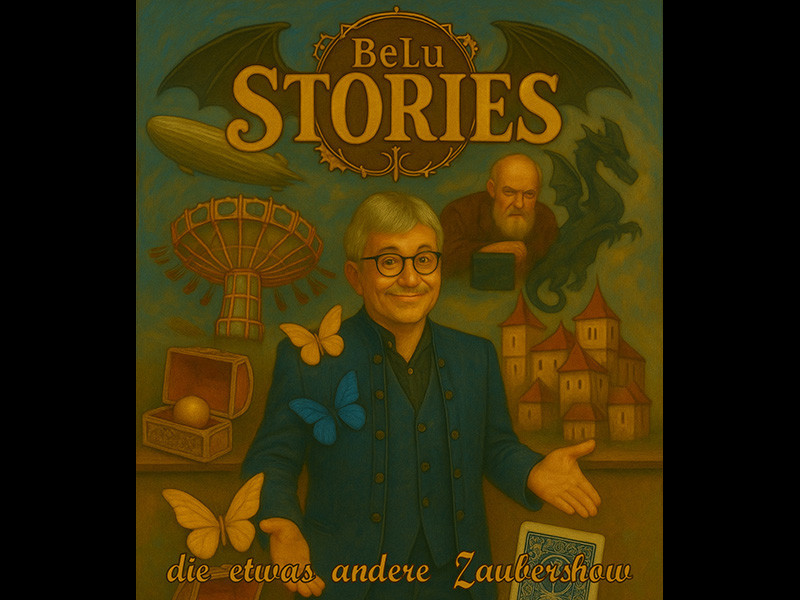Themen
Veranstaltungen in der Druckerei
Veranstaltungen
GISBERT STROTDREES liest

Buchvorstellung / Vortrag: Sprachen die Landjuden Plattdeutsch? Warum waren unter ihnen so viele als Viehhändler oder Metzger tätig – und so wenige als Landwirte? Gab es jüdische Kauffrauen? Wann und warum entstand ein Kibbuz in Westfalen? Was geschah beim Novemberpogrom 1938 auf dem Land? Und warum wurde nach Kriegsende 1945 ein ganzes Dorf zur ersten Bleibe für 750 befreite jüdische Zwangsarbeiterinnen?
Fragen wie diese führen mitten hinein in die vergessenen Welten jüdischen Landlebens in Westfalen. In seinem Buch zeichnet der Journalist und Historiker Gisbert Strotdrees das jahrhundertealte, in der NS-Zeit zerstörte jüdische Landleben zwischen Rhein und Weser nach und beleuchtet wenig bekannte, vergessene oder verdrängte Kapitel der Landesgeschichte. Strotdrees erinnert an Funde auf den Dachböden westfälischer Landsynagogen, an das Dirndl und seine wenig bekannten jüdisch-westfälischen Wurzeln oder auch an die die jüdischen Landmaschinenhersteller in Westfalen, die um 1920 den ersten Traktor Westfalens bauten. Der Blick geht in das Innere einer Landsynagoge an der Weser, in die Schule der Marks-Haindorf-Stiftung in Münster oder auch auf die Marktplätze Westfalens, auf denen sich Bauern und Viehhändler jahrhundertelang in „jüdischdeutscher“ Sondersprache über das Vieh verständigten. Außerdem geht der Autor auf den Novemberpogrom 1938 und die anschließende „Arisierung“ ein.
Der Autor Gisbert Strotdrees ist Historiker und Redakteur beim „Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben“, außerdem seit 2004 Lehrbeauftragter an der Universität Münster, Abt. Landesgeschichte. Er hat zahlreiche Bücher zur Landesgeschichte Westfalens veröffentlicht. Für sein Buch „Flurnamen in Westfalen“ wurde er 2021 mit dem Fritz-Reuter-Literaturpreis ausgezeichnet.
Mit freundlicher Unterstützung von Buch Scherer und Stolpersteine Bad Oeynhausen e.V.